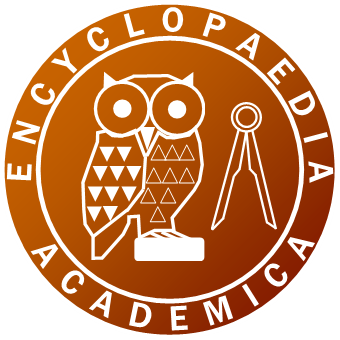Der Stachel des Sokrates
Für den Philosophen Sokrates war das Bewusstwerden über die menschlichen Schranken des Wissenkönnens eine Voraussetzung zur Erkenntnis. Mit diesem scheinbaren Widerspruch verunsicherte er seine Mitbürger mit ernsten Konsequenzen für sich selbst.
Sokrates gilt
als der Begründer der Philosophie, die den Menschen zum
Mittelpunkt des Denkens macht. Hatten die Philosophen vor ihm, die
Vorsokratiker, sich mit der äußeren Natur, den
kosmischen und göttlichen Dingen beschäftigt, so
stellte sich Sokrates die Frage, was denn der Mensch über sich
selbst wissen könne, was gut und schlecht für ihn sei
und was die Grenzen seines Wissens seien. Über die
Persönlichkeit und die Lehren des 469 v. Chr. in Athen
geborenen Sokrates lässt sich
wenig Sicheres sagen, denn das meiste was über ihn bekannt
ist, stammt aus teilweise widersprüchlichen Angaben seiner
Schüler. Seine Lehre wird recht zutreffend mit diesem ihm
zugeschriebenen Kredo auf den Punkt gebracht: „Ich
weiß, dass ich nichts weiß“. Mit dieser
Einstellung verunsicherte er nicht nur seine Mitmenschen, sie spielte
auch eine große Rolle bei dem Prozess, der für ihn
das Todesurteil bedeutete.
„Ich weiß, dass ich nichts
weiß“
Sokrates war ein unbequemer
Philosoph. Wer es wagte, an ihn eine Frage zu richten, so konnte er
nicht einfach eine Antwort von ihm erwarten, sondern musste damit
rechnen, mit noch mehr Fragen von dannen zu ziehen. Wenn er aber
wiederkehrte und das weitere Gespräch suchte, dann konnte er
hoffen, der Wahrheit näher zu kommen. Der Grund ist in dem
besagten berühmten Kredo zu finden. Eingebettet ist es in
Sokrates´ Art der Gesprächsführung, die
Mäeutik genannt wird. Die Mäeutik, das altgriechische
Wort für Hebammenkunst, ist Sokrates´ Vorgehen, den
Wissensdurstigen zur Erkenntnis im Dialog anzuleiten, also ihm bei der
„Entbindung“ des Wissens zu helfen. Dabei ging er
gemäß seinem Wahlspruch vor, so dass sein
Zuhörer nun wusste, wie wenig er doch eigentlich wisse. Das
Ergebnis war die Aporie, also übersetzt die Ratlosigkeit.
Durch ihre Herbeiführung soll der Ratsuchende von falschen
Einbildungen befreit werden, indem diese durch geschicktes Hinterfragen
Stück für Stück widerlegt werden. Alsdann
ist der Weg geebnet, um mit weiteren Fragen doch noch zur richtigen
Meinungsbildung zu gelangen. Diejenigen, die sich auf Sokrates
einließen, wussten die „Sokratischen
Dialoge“ zu schätzen. Ein glühender
Anhänger seiner Lehre wurde Platon (427-347 v. Chr.), dessen
besser überlieferte Lehren sich um einiges bedeutsamer als die
seines Lehrmeisters erweisen sollten.
Sokrates wusste aufzurütteln
Gerade durch die beim Gesprächspartner bezweckte Ratlosigkeit
musste Sokrates anecken. Sein Stachel saß tief, wenn er
wiederholt vermeintlich weise Herrscher, Dichter oder andere Leute von
Namen und Rang vorführte und in ihrem Selbstbewusstsein
erschütterte. Schließlich musste er sich
eingestehen, dass das Orakel von Delphi Recht hatte, wenn es
sinngemäß sagte: „Keiner ist so weise wie
Sokrates“. Freilich war er wegen seines Bewusstseins
über die menschlichen und somit seine eigenen Wissensgrenzen
den anderen voraus und Selbsterkenntnis war der Schlüssel
hierzu. „Erkenne dich selbst“ – diesen
auf einer Säule des Orakeltempels eingravierten Spruch gab
Sokrates eine neue Deutung. Selbsterkenntnis hatte bei den
Vorsokratikern zunächst zur Eindämmung der
Anmaßung gegenüber den Göttern gedient,
woraus später eine überaus optimistische Suche nach
der in der Seele wohnende Klugheit geworden war. Beides verwarf nun
Sokrates.
Das passte aber so gar nicht zu dem Selbstverständnis seiner
Zeitgenossen, die von der unumstößlichen Weisheit
als einem erreichbaren Ideal ausgingen. Sein Schüler Platon
fand den Vergleich von Sokrates mit dem
„Zitterrochen“ ganz zutreffend, da auch Sokrates
seinem Gegenüber gewissermaßen elektrische
Schläge versetzen konnte. Platon nennt ihn auch
„Atopos“, was wohlwollend mit
„ungewöhnlich“ und weniger wohlwollend mit
„deplaziert“ übersetzt werden kann. Auch
Sokrates´ Äußeres war nicht allzu
vorteilhaft, um sich der Gesellschaft einzuschmeicheln. Antike
Skulpturen zeigen ihn als einen eher kleinen, dicken,
vollbärtigen Mann mit dumpfem Blick, der den Eindruck
erweckte, geistig träge zu sein. Ein solches Erscheinen
alleine reicht freilich für eine Außenseiterrolle
nicht aus. Zu dieser trug er tatkräftig bei, indem er sich wie
viele andere große Denker nachlässig im Umgang mit
seinem Äußeren, wie etwa bei seinem Kleidungsstil
zeigte. Für solch einen eigenartigen „Typ“
ist es fast ein Wunder, dass er eine Frau fand.
Und wurde durch Xanthippe durchgerüttelt
Womöglich deshalb bekam Sokrates die Frau, die er verdient
hatte. Xanthippe war ihr Name und sie beschenkte ihn mit drei
Söhnen und noch viel mehr Sorgen. Sie soll
nörglerisch, streitsüchtig, unnachgiebig und rundum
bösartig gewesen sein. Einmal, so will es die
Überlieferung, schüttete Xanthippe den Nachttop in
einem Tobsuchtsanfall über dem vorm Haus weilenden Sokrates
aus, der daraufhin hervorrief: „Seht ihr, wenn meine Frau
donnert, spendet sie auch Regen!“ Doch auch etwas profunder
wusste Sokrates seine Ehe zu verteidigen. Die Wahl sei auf seine Frau
gefallen, da die Erduldung ihrer Wesensart der Geduld eines Reiters
gleiche, der ein wildes Pferd zähme. Und so wie dieser Reiter
alle Pferde zähmen könne, wenn er sich am wildesten
erfolgreich erprobt habe, so helfe ihm selbst sein Umgang mit Xanthippe mit
allen Menschen umgehen zu können. Riss dem Sokrates mit seiner
Frau einmal wieder der Geduldsfaden, und das kam oft vor, dann
„beglückte“ er seine Athener
Mitbürger in den Gassen und auf den Plätzen mit
seinen Dialogen aber auch grüblerischen
Zwiegesprächen mit sich selbst. Letztere zogen sich auch mal
über den ganzen Tag und die ganze Nacht hin und trugen mit zu
seinem Ruf eines Sonderlings bei.
Der Preis der Unbeugsamkeit
Die „zudringliche Bremse“ Sokrates,
„welche dem schönen Pferde Athen von einem Gotte auf
den Nacken gesetzt sei, um es nicht zur Ruhe kommen zu
lassen“ (Friedrich Nietzsche, Menschliches,
Allzumenschliches) wurde den Athenern irgendwann lästig. Dem
inzwischen Siebzigjährigen wurde schließlich ein
Prozess gemacht und ihm zur Last gelegt, er verderbe die Jugend und
erkenne die griechischen Götter nicht an und setze andere an
ihre Stelle. In seiner Verteidigungsrede vor über 500 aus dem
Volk gelosten Geschworenen widerlegte er zwar unter Erläuterung seiner
Philosophie erfolgreich die gröbsten Verleumdungen, trat aber
anmaßend auf und bot so den Anklägern eine
Steilvorlage. Mit einer Mehrheit von 61 Stimmen wurde er für
Schuldig befunden, und da fortan Sokrates auch noch das Gericht eines
falschen Urteils bezichtigte, sah man auch nicht davon ab, das Urteil
abzumildern – obwohl man sich ein falsches Urteil insgeheim
eingestand. So fand Sokrates 399 v. Chr. durch den Schierlingsbecher
den Tod.
Autor: Dipl.-Bw. (FH) Michael Zabawa
Erschienen: Oktober 2011